Komplexität – ignorieren oder reduzieren?
Die Basis von systemtheoretischen Betrachtungen ist die System-Umwelt-Differenz. Ein System kann ohne seine Umwelt nicht verstanden werden und gleichzeitig grenzt sich das System von seiner Umwelt ab. Wäre das nicht der Fall, wäre das System und seine Umwelt identisch. Theoretisch denkbar, aber wenig praktikabel. Vergleichbar mit einer Landkarte, die das Gebiet exakt 1:1 abbilden würde.
Das wirft Fragen auf: Was wird ignoriert, was nicht? Und ich sage bewusst „ignorieren“. Ich reite da in letzter Zeit häufiger darauf herum und mich würde sehr eure Meinung dazu interessieren. Lässt sich Komplexität im wahrsten Sinne reduzieren?
Ich glaube nein. Laut Gerhard Wohland ist Komplexität eine Systemeigenschaft, also binär: Ein System ist komplex oder nicht.
Luhmann hingegen sagt:
„Komplexität bedeutet: mehr Möglichkeiten, als aktualisiert werden können.“
(Luhmann, N. (1984). Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp)
Während Wohland Komplexität als binäre Eigenschaft eines Systems betrachtet, betont Luhmann die Relation zwischen Möglichkeiten und Selektionen. Komplexität ist nicht nur eine Frage der Anzahl an Elementen, sondern auch der Art der Relationen zwischen ihnen. Ein System ist dann komplex, wenn es mehr Möglichkeiten gibt, als es realisieren kann – also wenn es selektieren muss.
Ein Motor beispielsweise kann aus vielen Elementen bestehen, aber wenn deren Beziehungen rein linear und vorhersehbar sind, bleibt er kompliziert – nicht komplex. Eine Ehe hingegen, bestehend aus nur zwei Menschen, kann hochkomplex sein, weil die Beziehungsmuster nicht-linear und nicht vorhersehbar sind.
Daraus folgt: Es reicht nicht aus, nur die Anzahl der Elemente zu betrachten. Entscheidend ist die Art der Relationen – und genau hier zeigt sich, dass Komplexität eben nicht „reduziert“ werden kann.
Ich komme immer wieder auf den Schluss, dass sich Komplexität nicht reduzieren lässt. Das mag pfennigfuchserisch wirken, aber sprachliche Präzision ist essenziell, insbesondere in der Systemtheorie.
Was wir meinen, wenn wir „Komplexität reduzieren“, ist, dass bewusst Möglichkeiten aus der Umwelt ignoriert werden. Doch welche ignoriert werden und welche nicht, ist keine triviale Frage.
Und wenn ein System nicht so komplex ist wie seine Umwelt, dann ist die relevante Frage: Wo ist die Komplexität hin – sie kann ja nicht weniger werden, wie gerade erläutert?
Die Umwelt bleibt genauso komplex wie zuvor, aber das System verarbeitet nur einen Teil dieser Komplexität durch Selektionen. Der Rest wird ignoriert.
Meine Vermutung ist, dass diese Differenz u. a. in Form von „Annahmen“ kompensiert wird. Bei uns Menschen heißen diese (größtenteils impliziten) Annahmen „Glaubenssätze“. In Organisationen sprechen wir von Kultur. Annahmen, die versteckt im Hintergrund mitlaufen, die als Selbstverständlichkeit angesehen werden, um so Teile der Umwelt zu ignorieren.
Man könnte also sagen, dass Kultur eine Konsequenz aus der Notwendigkeit ist, an der Grenze zwischen Umwelt und System Komplexität zu ignorieren.
Aber die Komplexität ist nicht weg. Wird der „richtige“ (also irrelevante) Teil der Umwelt ignoriert, ist die Ignoranz funktional für das System. Die Grenze zwischen System und Umwelt ist aber nicht statisch, sondern dynamisch. Die einst funktionalen Annahmen können dysfunktional werden. In Organisationen, wie bei uns Menschen.
Deswegen kann Beratung und Coaching not-wendig werden.
Ich freue mich auf eure Kommentare. Wo ist mein Denkfehler?
Fun Fact:
Das Wort kompliziert stammt aus dem Lateinischen. Es leitet sich von complicare ab, was „zusammenfalten“ bedeutet (com- = „zusammen“, plicare= „falten“).
Bildlich gesprochen lässt sich etwas das gefaltet wurde, wieder entfalten.
Das Wort komplex stammt ebenfalls aus dem Lateinischen (complexus) und bedeutetet „umfassend, umschließend, verflochten“. Das zugrundeliegende Verb complecti setzt sich aus com-(„zusammen“) und plectere(„flechten, verflechten“) zusammen.
Bildlich ist der Unterschied schön zu verstehen: Etwas, das verflochten ist, kann nicht ohne weiteres entflochten und auf die gleiche Weise wieder verflochten werden.
Foto von Kier in Sight Archives auf Unsplash
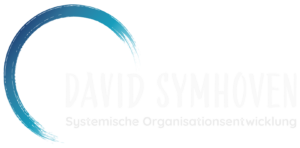
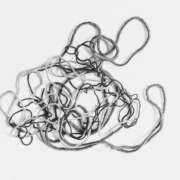 Foto von
Foto von 







